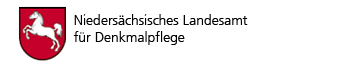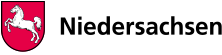MehrWert zu Gast im Leineschloss
Am Montag hat Landtagspräsidentin Hanna Naber die Ausstellung »Denkmalpflege. MehrWert als du denkst.« mit starken Worten eröffnet:
Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung „Denkmalpflege. MehrWert als du denkst“ hier bei uns im Niedersächsischen Landtag.
Oder – wenn Sie es ganz genau wissen wollen:
„in einem „freistehenden, unregelmäßigen Gebäudekomplex in Sandstein, errichtet 1637 in Fachwerkbauweise, heute überwiegend klassizistisch, mit einem mittigen Portikus auf sechs korinthischen Säulen, einem überdachten Innenhof, einem 130 Meter langen Flügel entlang der Leine, unter Mansardwalmdach – ehemaliges Schloss, heute Sitz des niedersächsischen Landtags.“ (Denkmalatlas Niedersachsen)
So zumindest steht es neben rund 100.000 weiterer Objektbezeichnungen im Denkmalatlas Niedersachsen. Und ich finde: So sachlich das klingt – dem einen oder der anderen unter Ihnen dürfte bei solch einer Beschreibung sicherlich das Herz aufgegangen sein.
Dass wir diese Ausstellung ausgerechnet hier eröffnen, ist kein Zufall. Es ist ein bewusst gesetzter Rahmen – und, liebe Frau Dr. Krafczyk, ein wirklich schöner Vorstoß von Ihnen und Ihrem Haus.
Sie haben mich mit Ihrem Schreiben Ende Mai dieses Jahres sehr schnell überzeugt. Sie begannen nämlich mit der wunderbar provokanten Frage:
„Was machen die eigentlich in der Denkmalpflege – außer krass rumzunerven?“
Und ich dachte mir – ganz pragmatisch: Die Antwort hole ich mir einfach ins Haus und habe Ihrem Anliegen gerne zugestimmt.
Und wenn nicht der Landtag – welches Gebäude in Niedersachsen sonst, könnte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eindrucksvoller verbinden als dieses?
Es war einst Kloster, dann Heimat eines der prächtigsten Opernhäuser Europas, königliche Residenz, Ort der ersten Allgemeinen Ständeversammlung im 19. Jahrhundert, später Residenz des deutschen Kaisers, dann Kriegsschauplatz, Ruine, Armenhaus, Wiederaufbauprojekt – und ist heute Sitz des frei gewählten Parlaments unseres Landes.
Oder, wie ich es gerne zu sagen pflege: die Herzkammer unserer Demokratie in Niedersachsen.
In der Einladung heißt es so schön, hochwertige Bilder und inspirierende Geschichten eröffnen einen neuen, überraschenden Zugang zur Denkmalpflege. Essays zu gesellschaftlich relevanten Themen machten deutlich, wie sehr Denkmalpflege mit den großen Fragen unserer Zeit verbunden ist – mit Identität, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt.
Aber ich wollte es dann doch etwas genauer wissen.
Man kann sich diesem Thema ja auf ganz unterschiedliche Weise nähern: praktisch – mit Restaurierungspinsel, Kalkputz und viel Geduld – oder theoretisch – mit einem Blick in § 3 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes: „Begriffsbestimmungen“.
Ich habe einen dritten Weg gewählt: den Griff ins Bücherregal meines Präsidentinnenbüros. In gut zweieinhalb Metern Höhe thront dort der gute alte Brockhaus – fast selbst schon ein Denkmal des analogen Zeitalters.
Vor allem aber bringt er die Sache in wohltuender Klarheit auf den Punkt:„Denkmalpflege ist die kulturell begründete und gesetzlich geregelte Bewahrung von Gegenständen, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt.“
Aber dahinter steckt etwas sehr Menschliches: Denkmalpflege gibt der Zeit ein Gedächtnis. Sie bewahrt, was uns geprägt hat – Häuser, Plätze, Spuren –, und erinnert uns daran, dass unsere Gegenwart Wurzeln hat. Es geht nicht um Stillstand, sondern um Sinn: Wer weiß, woher er kommt, versteht besser, wohin er will.
Ich bin vielen solcher Orte auf meiner diesjährigen Sommerreise begegnet – vier Tage, neunzehn Stationen, rund eintausend Kilometer kreuz und quer durch Niedersachsen.
Und erst im Rückblick wurde mir bewusst, wie viele dieser Orte tatsächlich unter Denkmalschutz stehen – und wie viel sie über uns erzählen: über das, was uns ausmacht, was wir bewahren, und worauf wir als Gesellschaft bauen können.
Da war zum Beispiel die alte Herrenmühle in Ebergötzen in Südniedersachsen: Seit fast 500 Jahren steht sie dort – und durch Wilhelm Busch wurde sie weltberühmt.
Als Junge spielte er hier mit dem Müllerssohn, den späteren Vorbildern für Max und Moritz. Wer hier steht, spürt, wie Kindheitserinnerungen und Geschichte lebendig werden.
Am nächsten Tag war ich in Wolfenbüttel, in der alten Justizvollzugsanstalt – heute ein Ort des Gedenkens, früher ein Ort des Schreckens. Bis 1945 diente sie als zentrale Haftanstalt des Freistaats Braunschweig und zugleich als Hinrichtungsstätte sogenannter „Volksschädlinge“, Widerstandskämpferinnen und -kämpfer oder sog. „Berufsverbrecher“. Ein Ort, der das Unfassbare sichtbar macht.
Dann war da noch die Freilichtbühne Stedingsehre im Oldenburger Land – ein Platz, an dem sich zeigt, wie Geschichte bewusst inszeniert wurde.
Die Nationalsozialisten nutzten ihn in den 1930er-Jahren für ihre Blut-und-Boden-Ideologie. Im Denkmalatlas heißt es, die „vielseitige Verwendung für Propagandazwecke“ sei einmalig und verleihe dem Ort bis heute eine besondere Bedeutung für die Erforschung der NS-Zeit.
Ganz anders mein Besuch im Freilichtmuseum am Kiekeberg, an der Grenze zu Hamburg. Dort beeindruckte mich die neue Königsberger Allee, ein Straßenzug aus der Nachkriegszeit. Haus für Haus durchschreitet man Jahrzehnte deutscher Alltagsgeschichte – vom Siedlungshaus bis zur Tankstelle, von der Telefonzelle bis zum Friseursalon.
Ich könnte viele weitere Beispiele nennen – etwa das 3D-Modell des zerstörten Goslarer Doms oder das Waisenheim in Bad Sachsa, in dem die Kinder der Attentäter des 20. Juli 1944 untergebracht wurden.
All diese Orte – so unterschiedlich sie sind – verbindet etwas:
Sie laden uns ein, genauer hinzusehen. Sie fordern uns auf, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen –nicht, um in ihr zu verharren, sondern um zu verstehen, was sie uns für die Gegenwart zu sagen hat.
Und darin liegt, glaube ich, der eigentliche Wert der Denkmalpflege.
Sie schafft Räume des Nachdenkens und des Dialogs. Sie bewahrt nicht nur Mauern oder Handwerkskunst, sondern auch Erinnerungen, Haltungen, Werte.
Sie hält uns einen Spiegel vor – und manchmal auch einen Kompass hin.
Als Landtagspräsidentin glaube ich, dass darin – eben auf den zweiten Blick – auch ein stiller aber durchaus entscheidender Beitrag zur Demokratie steckt.
Denn eine Demokratie, die weiß, woher sie kommt, die sich ihrer langen Wirrungen und Wurzeln bewusst bleibt, die auch die Brüche und Zumutungen ihrer Geschichte nicht verdrängt – eine solche Demokratie ist widerstandsfähiger.
Denkmalpflege bietet daher auch einen MehrWert, unsere Demokratie im Hier und Jetzt besser verstehen zu können.
Albert Schweitzer hat einmal gesagt: „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“ Ich finde, das gilt auch – und vielleicht ganz besonders – für diejenigen, die sich tagtäglich um unsere Denkmale in Niedersachsen kümmern.
Denn ihr Engagement für die Erhaltung dieser Orte, für Geschichte, für Identität, für Sinn und Zusammenhang, verdienen tatsächlich unser aller Dankeschön!
Sie nerven nicht, ganz im Gegenteil, Sie leisten einen wichtigen Dienst an unserer gemeinsamen Erinnerung.
Ihnen allen – und ganz besonders Ihnen, liebe Frau Dr. Krafczyk – möchte ich im Namen des gesamten Niedersächsischen Landtages unseren ausdrücklichen Dank aussprechen.
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen eindrucksvollen, interessanten Abend und der Ausstellung in den kommenden Tagen und Wochen einen vollen Erfolg.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die MehrWert-Kampagne haben die bundesweiten Denkmalfachämter anlässlich 50 Jahre europäischem Denkmalschutzjahr initiiert, um die Strahlkraft und Akzeptanz von Denkmalpflege zu erhöhen. Sie stellt sich der Frage, ob und wie das Thema Denkmalpflege in den Lebenswelten der Menschen wirklich verankert ist. Dann räumt sie mit landläufigen Klischees auf, denn Denkmalpflege schont Ressourcen, erhält Geschichte, besitzt Reparaturwissen und ist nachhaltiger als gedacht. Denkmalpflege stiftet Identität und eröffnet eine moderne, offene und einladende Kommunikation. Diese Aspekte wurden auf dem prominent besetzten Podium mit Staatssekretär Prof. Dr. Joachim Schachtner, Dr. Thela Wernstedt, Präsidentin der Klosterkammer Hannover, und Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, diskutiert. Kontrovers wurden Positionen zu Grenzen der Erhaltung – wenn der Einzelne ein Baudenkmal pflegt – erörtert oder die Verpflichtung, historische Bauten in das Korsett gültiger aktueller Standards zu zwängen, wie aktuell bei der Sanierung des historischen Museums in Hannover, abgewogen.
Es stimmen am Ende alle zu, wenn gefragt wird, "Wozu brauchen wir den alten Krempel überhaupt?" Denn: Jeder will an mehr Reichtum dank Kulturerbe profitieren. Jeder will den Wissensspeicher für die Aufgaben der Zukunft nutzen, Identität bewahren und Attraktivität erhalten – auch für den Arbeitsmarkt. Die dem zugrundeliegenden Ressourcen – da ist man sich auf dem Podium einig – sind unerlässlich.
Die Ausstellung ist in der Portikushalle des Niedersächsischen Landtages, Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover, bis zum 23.11.2025 täglich von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu sehen. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege lädt zum offenen Gespräch in der Ausstellung vom 18.11.2025 bis zum 20.11.2025 jeweils von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein.